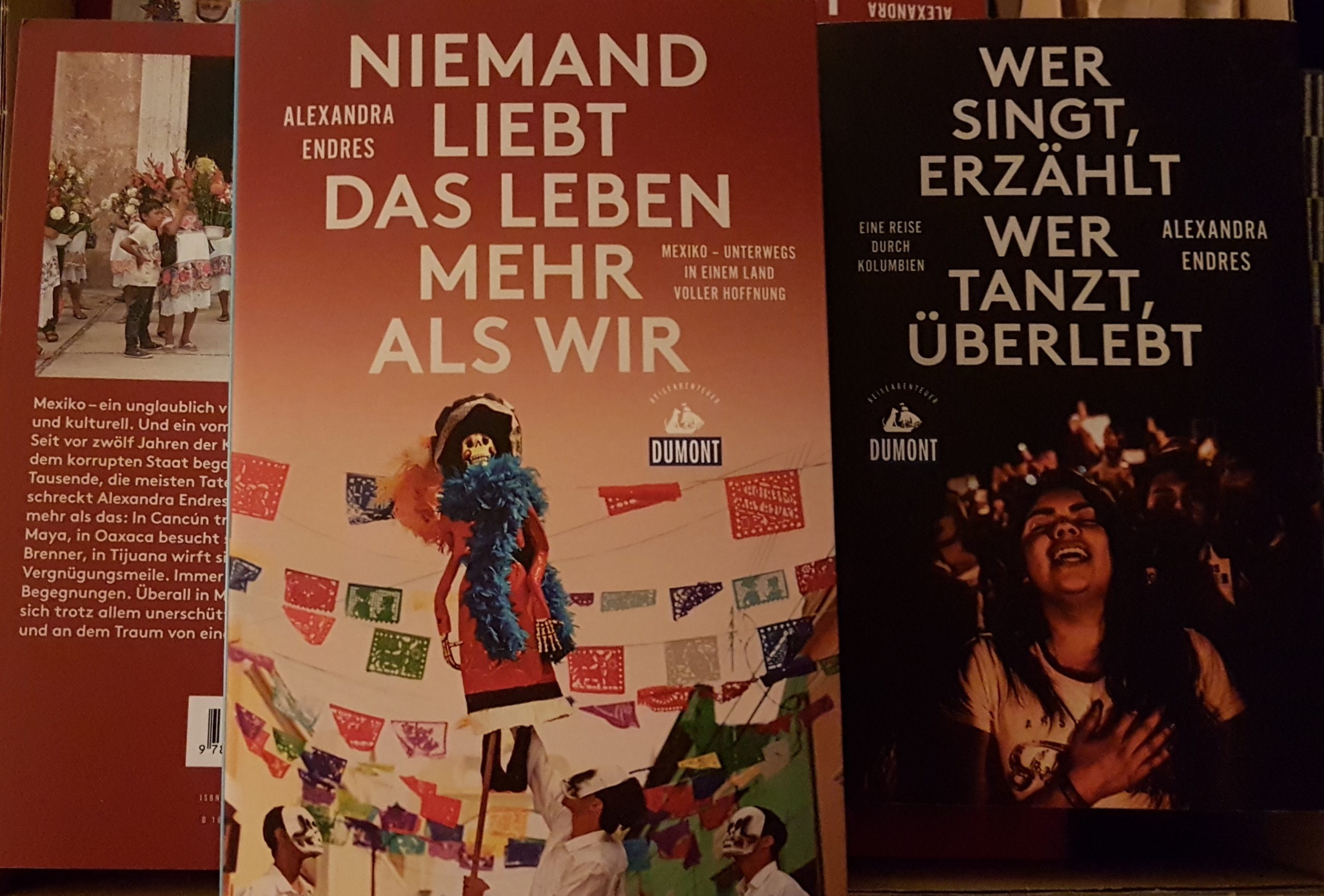Ein Wahlsieg für Francia Márquez
Kolumbien hat einen neuen Präsidenten gewählt. Der offizielle Sieger dieser Wahl ist Gustavo Petro (der hier im Spiegel von Jens Glüsing nuanciert porträtiert wird, leider nur mit einem Spiegel-Abo lesbar).
Warum schreibe ich „offizieller Sieger“? Natürlich ist es Petro, der für das Präsidentenamt kandidiert hat und gewählt wurde. Aber ich glaube: Ohne Francia Márquez hätte er es nicht geschafft. Sie hat gemeinsam mit Petro kandidiert und ist jetzt seine Vizepräsidentin – die Repräsentantin der „Niemande“ Kolumbiens, die nun eine Stimme in der Regierung haben. Sie hat die Menschen vor allem in den ländlichen Regionen, die oft vom Staat vergessen sind und besonders stark unter der Gewalt leiden, mobilisiert.